Arbeitszeitbetrug kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Allerdings muss der Arbeitgeber dieses vertragswidrige Verhalten nachweisen können. In diesem Artikel zeigen wir, wann ein Arbeitsverhältnis wegen Arbeitszeitbetrugs fristlos gekündigt werden kann und wie Arbeitgeber den möglichen Arbeitszeitbetrug datenschutzkonform aufdecken und nachweisen können.
Der Inhalt im Überblick
- Was ist Arbeitszeitbetrug?
- Wie kann man Arbeitszeitbetrug (im Homeoffice) nachweisen?
- Arbeitnehmerdatenschutz bei Verdacht auf Arbeitszeitbetrug beachten
- Folgen der rechtswidrigen Auswertung von Beschäftigtendaten
- Abmahnung oder Kündigung bei Arbeitszeitbetrug möglich
- Verdacht auf Arbeitsbetrug: IT-Forensik wäre eine Lösung
Was ist Arbeitszeitbetrug?
Manche Mitarbeiter verbringen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit, private Angelegenheiten an ihrem Dienstrechner zu erledigen, anstatt sich ihren eigentlichen Aufgaben am Arbeitsplatz zu widmen. Dabei handelt es sich dann um Arbeitszeitbetrug, wenn die Mitarbeiter diese Zeiten vorsätzlich fälschlicherweise als Arbeitszeit erfassen, obwohl sie sich in der Zeit mit privaten Aktivitäten wie Zeitung lesen, Fitness, Einkaufen oder Hausarbeiten beschäftigt haben.
Der Arbeitszeitbetrug liegt darin, dass ein Mitarbeiter vorsätzlich seine Arbeitszeit falsch angibt und sich somit Arbeitszeit bezahlen lässt, in der er gar nicht gearbeitet hat. Dies kann beispielsweise durch das Melden von Überstunden, die nicht tatsächlich geleistet wurden, das Versäumen der Registrierung von Pausen oder das Eintragen von Arbeitsbeginn oder -ende zu Zeiten, zu denen tatsächlich keine Arbeit verrichtet wurde, geschehen.
Aktuellen Umfragen nach hat dieses Verhalten entweder oft mit den Chefs zu tun. In der Praxis ist es allerdings oft schwierig, Arbeitszeitbetrug bei „New Work“-Modellen nachzuweisen und abzugrenzen. Denn einige Unternehmen bieten heutzutage als eine Form von „Work-Life-Balance“ ihren Mitarbeitern an, die Arbeitszeiten selbst festzulegen und zu erfassen. Solche „New Work“ Konzepte sollten keinesfalls als Freifahrtschein für die Vernachlässigung der Arbeit missverstanden werden. Arbeitszeitbetrug tritt dann auf, wenn Mitarbeiter weniger Zeit arbeiten, als sie eigentlich sollten bzw. angegeben haben, selbst wenn das von ihnen erwartete Arbeitsergebnis erbracht haben.
Wie kann man Arbeitszeitbetrug (im Homeoffice) nachweisen?
Der Nachweis von Arbeitszeitbetrug ist nicht einfach, insbesondere bei flexiblen Arbeitszeiten oder bei Arbeit im Homeoffice. Oftmals spielen Zeugenaussagen und Dokumente in späteren Prozessen eine entscheidende Rolle. Beispielsweise könnten fehlerhaft ausgefüllte Zeiterfassungsformulare vorgelegt oder Augenzeugen bestätigen, dass der Arbeitnehmer zu spät am Arbeitsplatz erschien.
Die Installation von Überwachungssoftware auf den Computern der Mitarbeiter mag zunächst als effizienter Weg erscheinen, aber eine dauerhafte Überwachung des Arbeitnehmers ist gemäß der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Az.: 1 ABR 16/07) in der Regel unzulässig. Überwachungsmaßnahmen sind strengen Grenzen unterworfen und eine fristlose Kündigung, die sich auf die Ergebnisse unrechtmäßiger Überwachungsmaßnahmen stützt, kann von den Arbeitsgerichten für unwirksam erklärt werden.
Nur wenn der Arbeitgeber einen konkreten Verdacht hat, darf er unter bestimmten Umständen den Dienstcomputer seiner Beschäftigten auswerten. In solch einem Fall kann mit Hilfe der IT-Forensik nachvollzogen werden, mit welchen Dateien und Programmen der Nutzer zuletzt interagiert hat, da viele Interaktionen Spuren im Betriebssystem hinterlassen. Hinweise auf eine bestimmte Internetnutzung können beispielsweise durch die Auswertung der Browsernutzung gewonnen werden, insbesondere durch die Analyse der Browser-History, des Browser-Cache mit Informationen zu besuchten Seiten samt Zeitstempeln und Benutzerprofil, der Cookie-Informationen, der Download-History, von angelegten Lesezeichen etc. Vergleicht man diese Daten mit den Pausenzeiten des Arbeitnehmers, lassen sich Rückschlüsse auf Arbeitszeitbetrug ziehen.
Arbeitnehmerdatenschutz bei Verdacht auf Arbeitszeitbetrug beachten
Zur Aufdeckung des Betrugs können die personenbezogenen Daten des betroffenen Mitarbeiters verarbeitet werden, dabei müssen die Vorgaben des Arbeitnehmerdatenschutzes beachtet werden.
Grundsätzlich kommt als Rechtsgrundlage für eine – ausnahmsweise – zulässige Verarbeitung von Beschäftigtendaten § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG in Betracht. Nach § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern unter gewissen Umständen zur Aufdeckung von Straftaten des Arbeitnehmers (z.B. Arbeitszeitbetrug) zulässig. Danach:
dürfen zur Aufdeckung von Straftaten personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
Wie konkret muss der Anfangsverdacht sein?
Voraussetzung ist jedoch, dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. Ein „bloßer Verdacht“ aufgrund von vagen Hinweisen oder bloßen Gerüchten reicht nicht aus. Es soll verhindert werden, dass aufgrund vager Anhaltspunkte oder bloßer Vermutungen schwerwiegende Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten stattfinden.
Es ist ein „einfacher Anfangsverdacht“ im Sinne des § 152 StPO erforderlich, also das Vorhandensein von „zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten“ für die Begehung der Straftat. Dabei wird verlangt, dass der Verdacht zumindest ansatzweise auf Tatsachen gestützt wird, auch wenn keine umfassende Tatsachenbasis vorhanden ist.
Beispielsweise könnte der Arbeitgeber aufgrund der von den Arbeitnehmern selbst eingereichten Zeitaufschreibungen und der in derselben Zeit erledigten Arbeitsmenge den konkreten Verdacht haben, dass die angegebenen Arbeitszeiten nicht korrekt sind. Die Beobachtung einer Kollegin, die im Vorbeigehen am Arbeitsplatz des Beschuldigten eine stark bebilderte Webseite gesehen haben will, die der Beschuldigte schnell weggeklickt hat, ist jedoch nicht ausreichend für einen Verdacht.
Anhaltspunkte dokumentieren
Die tatsächlichen Anhaltspunkte, die den Verdacht begründen, sollten elektronisch oder schriftlich dokumentiert werden, um zu beweisen, dass die Ermittlungen ursprünglich rechtmäßig waren. Diese Dokumentation ist auch im Rahmen der Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO erforderlich, wonach die Zwecke der Datenverarbeitung dokumentiert und deren Rechtmäßigkeit nachgewiesen werden muss.
Der zu dokumentierende Sachverhalt ist auf einen bestimmten Zweck beschränkt, nämlich die Untersuchung eines Straftatverdachts im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses. Dazu sollten Details wie entstandener Schaden, Kreis der Verdächtigen und die Indizien, warum die überwachten Personen verdächtig sind, festgehalten werden.
Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Aufdeckung des Arbeitszeitbetrugs
Auch wenn hinreichende Anhaltspunkte dokumentiert worden sind, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Datenverarbeitung zulässig ist. Dafür muss die aufklärenden Maßnahmen des Arbeitgebers erforderlich und verhältnismäßig sind. Dies ist der Fall, wenn das Aufklärungsinteresse des Arbeitgebers gegenüber dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers überwiegt. Zudem muss die geplante Datenverarbeitung zur Aufklärung der vermuteten Straftat grundsätzlich geeignet sein und das mildeste aller gleich geeigneten Mittel darstellen.
Je stärker der Verdacht wiegt und je schwerwiegender die Rechtsgutverletzung oder Gefährdung des Rechtsguts ist, desto intensiver darf der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht sein. Daher ist es schwierig, pauschal zu sagen, welche Maßnahmen für ein bestimmtes Verfahren zur Aufdeckung erforderlich und verhältnismäßig sind. Eine empfehlenswerte Vorgehensweise wäre jedoch, zunächst weniger eingriffsintensive Maßnahmen zu ergreifen und Dauer-Überwachungsmaßnahmen, z.B. durch eine systematische Videoüberwachung, zu vermeiden.
So kann der Einsatz von Spionage-Software auf dem Rechner der Mitarbeiter dem BAG nach als unverhältnismäßig eingestuft werden, wenn eine unter Anwesenheit durchgeführte Kontrolle des Dienst-PCs als milderes Mittel denkbar gewesen wäre. Hingegen können Zeitstempel von Dateien, an denen der Arbeitnehmer gearbeitet hat, nach Auffassung des LAG Köln (Az.: 2 Sa 181/14) in Verfahren verwertet werden, um nachzuweisen, dass die erfasste und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit auseinanderfallen.
Folgen der rechtswidrigen Auswertung von Beschäftigtendaten
Wenn gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wird, kann das dazu führen, dass Beweismittel nicht verwertet werden dürfen. Allerdings führt ein Verstoß gegen das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, durch den Informationen oder Beweismittel erlangt wurden, nicht automatisch zu einem Verwertungsverbot dieser Beweise.
Verstoß gegen die DSGVO kann zu Beweisverwertungsverbot führen
Obwohl das deutsche Zivilprozessrecht kein „Sachvortragsverwertungsverbot“ kennt, kann ein Verwendungs- und Verwertungsverbot nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) aber in Betracht kommen, wenn eine erhebliche, im Einzelfall nicht zu rechtfertigende Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt, da das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung überwiegt.
Das LAG Hamm (Az.: 16 Sa 1711/15) hat beispielsweise entschieden, dass eine fristlose Kündigung, die sich auf die Ergebnisse unrechtmäßiger Überwachungsmaßnahmen durch einen Keylogger stützt, aufzuheben ist.
Verletzung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats
Ein Verwertungsverbot ergibt sich grundsätzlich aber nicht aus der Nichtbeachtung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats bei der „Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen“, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Das BAG erklärte hierzu:
„Auch dann, wenn die Art der Datenverarbeitung bereits vor der erstmaligen Konstitution eines Betriebsrats im Betrieb durchgeführt wurde, steht dem Betriebsrat das Mitbestimmungsrecht zur automatischen Datenverarbeitung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG zu. Allerdings folgt hieraus nicht die Unverwertbarkeit der erhobenen Daten im Prozess (BAG vom 13.12.2007 – 2 AZR 537/06).“
Abmahnung oder Kündigung bei Arbeitszeitbetrug möglich
Ein Arbeitszeitbetrug kann oft eine fristlose Kündigung zur Folge haben. Dabei hebt das BAG (Az.: 2 AZR 682/12) hervor, dass der Vorwurf „Arbeitszeitbetrug“ dafür alleine schon ausreichend ist. Denn der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeitgeber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, ist an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung i.S.v. § 626 Abs. 1 BGB darzustellen.
Nur in Ausnahmefällen ist der Arbeitszeitbetrug für sich allein kein Kündigungsgrund. Etwa, wenn dem Unternehmen dadurch kein oder nur ein geringfügiger Schaden entstanden ist. So rechtfertigt nach Auffassung des LAG Berlin-Brandenburg (Az.:15 Sa 407/12) eine Falschangabe in der elektronischen Zeiterfassung keine ordentliche Kündigung, wenn der Arbeitnehmer durch diese nur wenige Überstunden aufbaue, die sich im Rahmen des Kontingents bewegen, das arbeitsvertraglich ohne weitere Vergütung abgegolten wird.
Verdacht auf Arbeitsbetrug: IT-Forensik wäre eine Lösung
Beim Verdacht auf Arbeitszeitbetrug sollten Arbeitgeber sehr sorgsam vorgehen. Eine Missachtung der Datenschutzbestimmungen kann zur Unzulässigkeit von Beweisen führen und eine daraus resultierende fristlose Kündigung unwirksam machen. Die IT-Forensik kann beim Nachweis gerade in Zeiten von Home-Office eine wertvolles Werkzeug sein, indem sie den Umgang des verdächtigen Mitarbeiters mit Dateien und Programmen nachverfolgt und so zur Aufklärung des Arbeitszeitbetrugs beiträgt. Vor allen Ermittlungsmaßnahmen empfiehlt es sich, dass der Datenschutzbeauftragte und – falls vorhanden – der Betriebsrat im Vorfeld eingebunden wird.
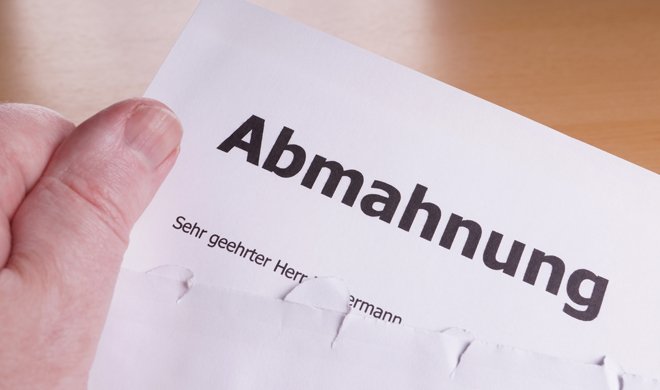







Komische Logik: Wer mehr Dateien ändert (Zeitstempel) oder mehr klickt, arbeitet auch mehr? Hä? Wer länger „anwesend“ ist, arbeit auch mehr?
Vielleicht sollten sich die Führungskräfte mal wieder drum kümmern, was die Mitarbeiter machen. Wenn die nämlich alle Aufträge zur vollsten Zufriedenheit abarbeiten, ist es ja egal, was sie in der restlichen Zeit machen. Oder soll man extra bummeln, damit es auch 8 Stunden dauert? Das ist alles letztes Jahrhundert.