Für Kinder ist die Einschulung ein ganz besonderer Moment, der natürlich auf Fotos festgehalten werden soll. Im Jahr 2019 befürchteten mehrere Grundschuldirektoren Verstöße gegen die DSGVO. Um möglichen Bußgeldern und juristischem Ärger zu entgehen, wurde an einigen Grundschulen ein totales Fotoverbot erlassen. Doch wie ist die Sachlage heute?
Der Inhalt im Überblick
Klarheit beim Fotografieren in der Schule
Es ist richtig und wichtig, auf den Datenschutz bei Fotos zu achten. Die oben dargestellte Weltuntergangsstimmung hat sich zum Glück verzogen und die meisten Unsicherheiten konnten beseitigt werden. Unter anderem haben einige Länder zum Glück die Situation erkannt und Hilfestellungen herausgegeben. Diese können als Leitfaden herangezogen werden. In diesem Artikel wollen wir die einzelnen Situationen des Fotografierens in der Schule erläutern und Lösungsvorschläge zeigen.
Das Haushaltsprivileg
Einzelfotos des eigenen Kindes sind selbstverständlich zulässig. Das Datenschutzrecht verbietet nicht, dass Eltern während einer Schulfeier Fotos von Ihren Kindern machen und diese dann ganz klassisch im „Familienalbum“ ablegen. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Fotos auf einem privaten Medium gespeichert werden und nur für den privaten Gebrauch bestimmt sind. Die DSGVO ist nämlich nicht anwendbar, wenn die Datenverarbeitung durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt, das sog. Haushaltsprivileg. Da ist es dann auch unbedenklich, wenn auf diesen Fotos Dritte zu sehen sind.
Die Grenze des Haushaltsprivilegs ist erreicht, wenn es darum geht, die Fotos der Kinder zu veröffentlichen – sei es in sozialen Medien, öffentlichen Webseiten, für einen größeren Nutzerkreis außerhalb des familiären Umfelds, durch elektronischen Versand über einen Messenger oder per Mail an eine größere Gruppe. Hier soll die DSGVO ihren Sinn und Zweck entfalten: das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung zu schützen.
Hausrecht und Fotoverbot
Außerdem haben die Schulen die Möglichkeit, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Den Schulen bieten sich grundsätzlich im Vorfeld folgende Möglichkeiten der Handhabe an:
- Die Schule macht von ihrem Hausrecht Gebrauch und verbietet das Fotografieren während der Veranstaltung ganz.
- Sie verbietet das Fotografieren während der Veranstaltung, bietet danach aber einen gesonderten Ort für Fotos an. Wer nicht fotografiert werden will, kann diesen Ort meiden.
- Sie holt von allen Teilnehmern eine Einwilligung ein, dass sie fotografiert werden dürfen. Wer das nicht will, kann ein Erkennungszeichen tragen.
Diese Möglichkeiten wurden damals vom Bildungsministerium den Schulen übermittelt. Aus Verunsicherung oder aus auch Angst vor möglichen Verstößen haben sich damals viele Schulleitungen dafür entschieden, ein Totalverbot gegen das Fotografieren auszusprechen. Es durften fortan keine Aufnahmen gemacht werden.
Ausnahmen vom Totalverbot?
Glücklicherweise kann der Gesetzgeber auf solche Situationen reagieren und entsprechende Gesetze erlassen. Aufgrund des Föderalismus ist in Deutschland die Bildung Ländersache. Es kann demnach unterschiedliche Gesetzeslagen in den Bundesländern geben, die zum Beispiel Ausnahmen zum Totalverbot vorsehen. (Bitte beachten Sie jeweils die Gesetzgebung Ihres Bundeslandes)
Der Gesetzgeber in Schleswig-Holstein ist tätig geworden und hat § 8 in seiner SchulDSVO eine solche Ausnahme erlassen, in der es heißt:
„(1) Die Erhebung personenbezogener Daten nach § 5 erfolgt durch die Schulleiterin oder den Schulleiter und das ihr oder ihm gegenüber weisungsgebundene Personal des Schulsekretariats.
(2) Gestattet die Schule im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nach § 17 Absatz 3 SchulG einem Dritten, zu dessen eigenen Zwecken bei einer schulischen Veranstaltung personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler zu verarbeiten, liegt die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit allein bei dem Dritten. Die Gestattung ist nur zulässig, wenn
1. die Angabe der personenbezogenen Daten freiwillig, jederzeit für die Zukunft widerruflich und nicht Voraussetzung für eine Teilnahme an der schulischen Veranstaltung ist und
2. die Schülerinnen und Schüler hierauf vorab mündlich und schriftlich hingewiesen werden.Die Schule hat frühzeitig
1. den Dritten auf diese Grundsätze hinzuwiesen und
2. die Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler über die vorgesehene Erhebung der personenbezogenen Daten durch den Dritten zu informieren.In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist eine Gestattung unzulässig.“
Es besteht also durch die Schulleitung die Möglichkeit der Gestattung für die Datenerhebung durch Dritte für die Erstellung von Fotografien und Videos auf schulischen Veranstaltungen. Eine Ausnahme für diese „Generalgestattung“ gilt jedoch für die Erstellung von Fotografien und Videos in den Jahrgangsstufen 1 bis 6.
Die Einwilligung als praktische Lösung
Die Anfertigung von personenbezogenen Foto-, Ton-, und Videoaufnahmen von Schüler:innen durch die Schule ist im Regelfall nicht von einer gesetzlichen Befugnis gedeckt und allenfalls aufgrund einer wirksamen, hinreichend konkreten Einwilligung zulässig.
Machen z.B. von Eltern Fotos von ihren eigenen Kindern und sind dabei auch andere, nicht zum Haushalt gehörende Kinder / Personen mit abgebildet, ist es zu empfehlen, sich vorher, zumindest mündlich, die Einwilligung einzuholen.
Auf die Einwilligungslösung haben vor ein paar Jahren die meisten Schulen verzichtet und sich für das Totalverbot entschieden. Damit haben sie prophylaktisch auf mögliche Verweigerungen der Erziehungsberechtigten reagiert. Denn hätte auch nur ein Erziehungsberechtigter seine Einwilligung nicht erteilt, dann wären alle Erziehungsberechtigten betroffen gewesen. Bei einer Einwilligung als Rechtsgrundlage bilden nämlich alle Betroffenen eine Schicksalsgemeinschaft, was die Einwilligung wiederum oftmals als stumpfes Schwert dastehen lässt (aus Sicht der Datenverarbeiter).
Heute wird die Einwilligung in der Praxis gelebt
Bei der Einholung der Einwilligung müssen regelmäßig mehrere Vorgaben beachtet werden, z.B. muss der Zweck für die Verarbeitung der Daten genau bestimmt sein, sodass die Erziehungsberechtigten genau wissen, wofür die Fotos ihrer Kinder verwendet werden. Eine Generaleinwilligung am Anfang eines Schuljahres in jegliche Fotos oder Videos durch die Schule ist nicht zulässig. Die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen haben in den Anlagen ihrer Landesverordnungen Vorlagen für die Einwilligung und zum Teil auch Vorlagen für Informationspflichten erstellt, in denen die weiteren Voraussetzungen detailliert nachgelesen und übernommen werden können.
Widerruf der Einwilligung
Widerruft ein Erziehungsberechtigter seine Einwilligung z.B. in die Verarbeitung eines Gruppenfotos, muss das betreffende Kind auf dem Foto unkenntlich gemacht werden, sofern dies praktikabel und nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Ist dies nicht möglich, muss das ganze Foto gelöscht werden.
Schulfremde Personen (Dritte)
Und wie müssen sich schulfremde Personen verhalten? Schulfremde Personen sind in der Regel Fotografen, die die Kinder fotografieren.
Wenn also der Fotograf für das Klassenfoto beauftragt wird, werden nicht mehr Daten im privaten oder familiären Umfeld verarbeitet. Der Fotograf muss infolgedessen die Vorgaben des Datenschutzes einhalten. Er ist insbesondere Verantwortlicher für die Verarbeitung der Fotos. Auch hier braucht es wieder die entsprechend ausdrückliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. der Schüler:innen vor dem Fototermin.
Wann sind Kinderfotos in sozialen Netzwerken rechtlich zulässig?
Eine besondere Sorgfalt muss insbesondere dann angewendet werden, wenn Bilder in sozialen Medien veröffentlicht werden.
Haushaltsprivileg in sozialen Netzwerken
Auch Aktivitäten in sozialen Netzen können unter das Haushaltsprivileg fallen. Die Datenschutzbehörden verlangen hierfür eine sehr genaue Differenzierung:
Sind die Fotos online
- auf einer öffentlich zugänglichen Webseite,
- in sozialen Netzwerken,
- für einen größeren Nutzerkreis außerhalb des familiären Umfelds
oder
- durch elektronischen Versand über einen Messenger oder per Mail an eine größere Gruppe
einem unbeschränkten Personenkreis zugänglich, kann von einer ausschließlich persönlichen oder familiären Nutzung nicht mehr gesprochen werden. In diesem Fall muss eine Einwilligung der Betroffenen bzw. der Erziehungsberechtigten oder eine andere Rechtsgrundlage der DSGVO vorliegen.
Werden die Fotos aber innerhalb geschlossener Nutzergruppen oder in passwortgeschützten Bereichen hochgeladen, ist der Anwendungsbereich des Datenschutzrechts nicht eröffnet.
Einwilligung in Upload in sozialen Netzwerken
Sofern die Schule Aufnahmen von Kindern machen und diese in sozialen Medien hochladen oder per Messenger an eine größere Gruppe weitergeben will, braucht es auch hier wieder die ausdrückliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. der Schüler:innen.
Außerdem sollte darauf hingewiesen werden, dass folgender Hinweis in die Einwilligung aufgenommen wird:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Fotoverbot bei der Einschulung ist keine Lösung
Für alle Beteiligten ist der Umgang mit dem Datenschutz nun nicht mehr allzu neu. Die Aufsichtsbehörden, die über die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen wachen, haben für viele Fragen inzwischen praktikable Lösungen zur Verfügung gestellt. Die DSGVO gibt zwar Normen vor, aber sie ist kein enges Korsett. Sie bietet Raum für vielfältige Lösungen. Ein Fotoverbot wäre vor ein paar Jahren sicherlich vermeidbar gewesen.
Umso erfreulicher ist es, dass es heute zum Glück mehrere Handlungshilfen mit Hinweisen und Praxistipps der Bildungsministerien oder Datenschutzbeauftragten der einzelnen Länder gibt, wie zum Beispiel die
- Hinweise zu Foto- und Videoaufnahmen an Schulen des Landes Schleswig-Holstein,
- das Arbeitspapier Foto- und Videoaufnahmen in der Schule, insbesondere im Schulunterricht des Freistaats Bayern oder
- die Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Datenschutz in Schulen des Freistaats Thüringen.
Das Datenschutzrecht verbietet uns nicht unseren gesunden Menschenverstand zu benutzen und vernünftige Ergebnisse zu präsentieren. Es ist ratsam sich in Zukunft mehr auszutauschen und sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu sein. Im vorliegenden Fall sind auch die Eltern gefragt keine Fotos zu verbreiten, besonders dann nicht, wenn man es auch für seine eigenen Kinder nicht möchte. So ist gewährleistet, dass unter der DSGVO differenzierte Lösungen möglich bleiben. Die Kinder werden es uns danken!


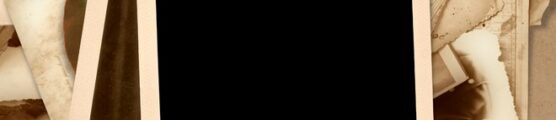



Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Leider ist die Abgrenzung zwischen den einzelnen Abschnitten für mich nicht ganz so leicht zu verstehen. Gilt beispielsweise in jedem Fall das Haushaltsprivileg, oder hole ich mir doch lieber eine Einwilligung von den betroffenen Personen, die mit meinen Kindern auf dem Foto sind, ein?
Interessant wäre zudem eine datenschutzrechtliche Einordnung zu dem Fall, dass Vertreter der örtlichen Presse bei der Einschulung zugegen sind, z.B. einer Onlinezeitung, und diese Fotos von den Kindern machen. Die Fotos werden im Anschluss zu der Veranstaltung gemeinsam mit einem Artikel über die Einschulung frei zugänglich im Internet veröffentlicht. Ist eine solche Vorgehensweise ohne Einwilligung der Eltern möglich?
Sofern das Foto auf einem privaten Medium gespeichert wird und nur für den privaten Gebrauch bestimmt ist, ist es unschädlich, wenn auch Dritte auf dem Foto zu sehen sind.
Zum Thema Fotos von Kindern durch die Presse können Sie die Ausführungen z.B. in den Hinweisen zu Foto- und Videoaufnahmen an Schulen des Landes Schleswig-Holstein nachlesen.
Ich bin ja gegen den „Internet“-Absatz. Weil eben nicht in die beschriebenen Exzesse eingewilligt werden soll, gehört das nicht IN die Einwilligung. Evtl. kann man außerhalb über Risiken informieren, z. B. nach der Unterschrift. Anders sieht es mit weiteren Zwecken aus, für die man (mit) verantwortlich wäre. Diese aufzuführen gehört zu den Bedingungen für die Wirksamkeit der Einwilligung. (Nicht Art. 7, sondern Art. 4.)
D., dem viele weitere… Dinge einfallen, die mit veröffentlichten Daten passieren können. Darüber lässt sich unmöglich abschließend informieren.
Danke für Ihre Ausführungen. Die Hinweise auf einen möglichen Missbrauch der Fotos im Internet müssen auch nach der Unterschrift und nicht innerhalb der Einwilligungserklärung aufgeführt werden, da solche Hinweise generell nicht einwilligungsbedürftig sind.
Hingegen sind die Zwecke der Datenverarbeitung natürlich umfassend in die Einwilligungserklärung aufzunehmen.
Ein gutes Beispiel findet sich beim Bayrischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.